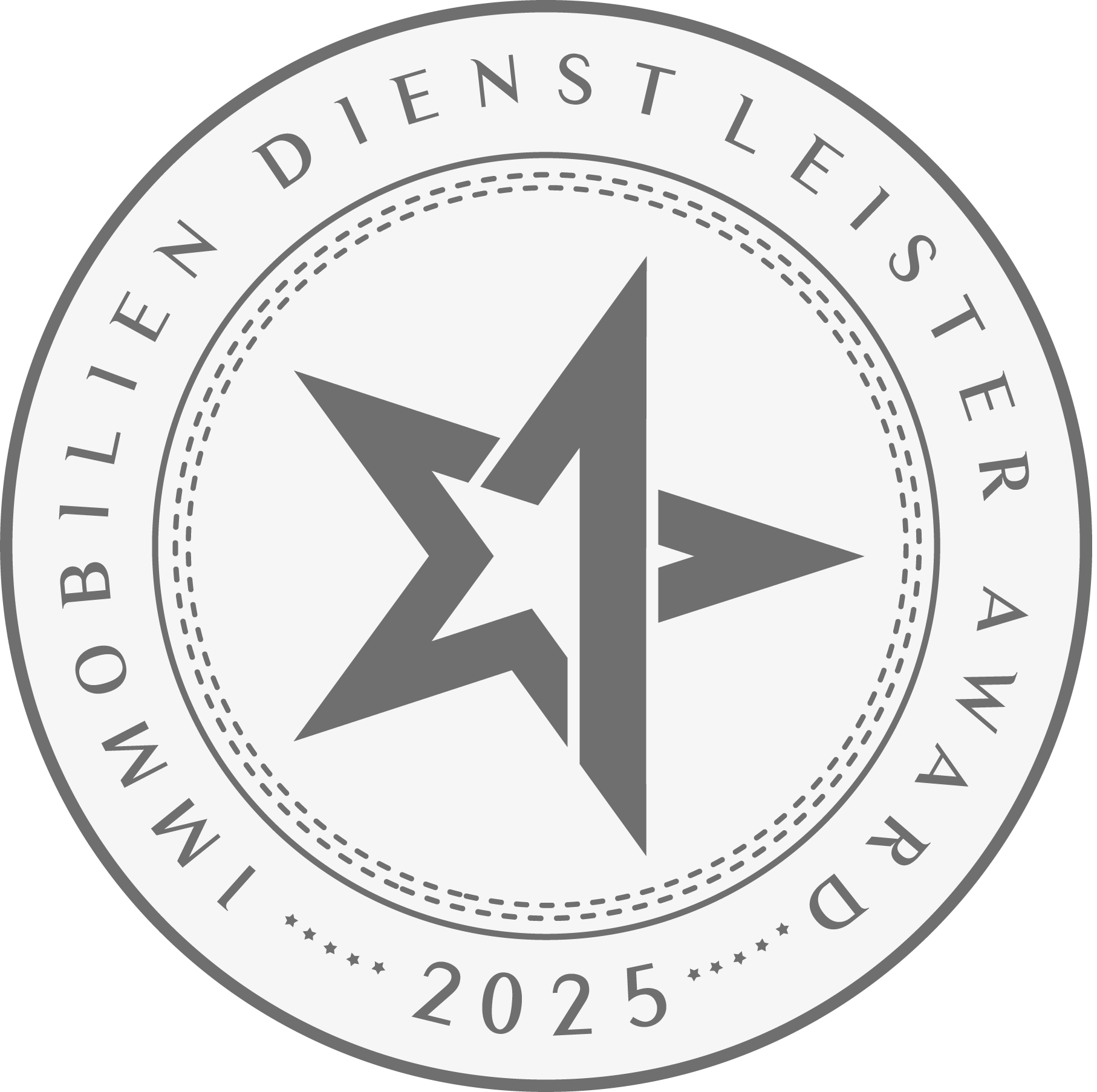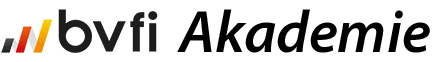Als der Hype um Künstliche Intelligenz begann, stand schnell eine Berufsgruppe auf der Liste der bald überflüssigen: der Immobilienmakler. Zu den ersten Annahmen gehörte, dass Software den Immobilienmarkt im Alleingang regeln könne. Ein paar automatisierte Exposés und Videos hier, ein intelligentes Matching-System dort – und fertig ist der Verkaufsprozess? Doch ganz so einfach ist es nicht. Da war manches der naiven Haltung geschuldet, mit einem bisschen Schlüsselumdrehen lassen sich Zigtausende verdienen.
Vergleichbar mit dem Beruf des Steuerberaters wurde vermutet: Es geht um Daten, Zahlen, Regeln – genau das, was eine KI besonders gut kann. Doch wer tiefer blickt, merkt schnell: Gerade diese Berufe sind nicht so leicht automatisierbar. Der Grund liegt in der Vielschichtigkeit der Rahmenbedingungen.
Ein zentrales Hindernis für eine vollständige Automatisierung liegt in den rechtlichen Rahmenbedingungen:
Was in Bayern erlaubt ist, kann in Hamburg schon problematisch sein. Was gestern galt, ist heute womöglich nicht mehr anwendbar. Eine KI müsste nicht nur alle Verordnungen im Blick haben, sondern sie auch kontextuell interpretieren können – eine große Herausforderung. Und sie müsste fortlaufend neue Kontexte integrieren, um richtig zu agieren.
Ein wichtiger Punkt ist die zwischenmenschliche Komponente: ein Scheidungspaar, das nur noch über den Makler kommuniziert; die Erbengemeinschaft, die alles über einen Anwalt regelt; der Eigentümer oder Mieter, der über einen gesetzlichen Betreuer verfügt; der Kranke, der jemanden bevollmächtigt hat.
Preisverhandlungen eines Vermittlers zwischen zwei Parteien verlaufen anders als ein Verkaufsgespräch eines KI-generierten Verkäufers mit einem Kunden. Verkäufer und Käufer haben häufig sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Wert einer Immobilie. Hier ist Einfühlungsvermögen gefragt, Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick. Oft entscheidet nicht der Preis allein, sondern die Art der Kommunikation über eine Einigung. Eine KI-generierte Antwort kann informativ sein, aber sie ersetzt keine facettenreiche Vermittlung einer persönlichen Situation, die in jedem Verkaufsfall einzigartig ist.
Wer in der Immobilienbranche arbeitet, weiß: Es gibt keinen Standardgesamtprozess. Jeder Vorgang ist individuell. Einige Beispiele:
Bereinigung von Übertragungsfehlern im Grundbuch
Fehlen von Unterlagen wie bemaßte Grundrisse oder Wohnflächenberechnungen
individuelle Anforderungen in Eigentümergemeinschaften
unklare Dokumentation von Sondernutzungsrechten
Unkenntnis über Miteigentumsanteile an Nebenflächen
Solche Herausforderungen lassen sich nicht durch ein standardisiertes System lösen. Sie erfordern Fachwissen, Erfahrung und oft auch Kreativität.
Das heißt jedoch nicht, dass KI keine Rolle spielt. Im Gegenteil: KI hilft uns, effizienter zu arbeiten.
Nur: Wer glaubt, dass ein automatisch generiertes Video aus einem Dutzend Fotos heute noch als Innovation gilt, hat den Markt nicht verstanden. Dies war bereits vor zwölf Jahren möglich. Ebenso verhält es sich mit automatisierten E-Mails oder Chatbots, die Standardanfragen beantworten sollen – hilfreich, aber längst kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern in jeder guten Maklersoftware seit langem enthalten.
Die Zukunft des Maklerberufs liegt nicht in der Verdrängung durch Technologie, sondern in der klugen Kombination von Fachwissen, Erfahrung und digitaler Unterstützung. KI kann viel – aber nicht alles. Und gerade das, was Immobilienvermittlung so besonders macht, liegt oft zwischen den Zeilen und zwischen Programmiercode. Dort wird der Makler auch in Zukunft gefragt sein.
Ich gebe meine Empathie nicht an KI ab. Ihretwegen nicht. Und meinetwegen nicht.
München | Hamburg | LüneburgSpanien | Zypern | VAE | Oman